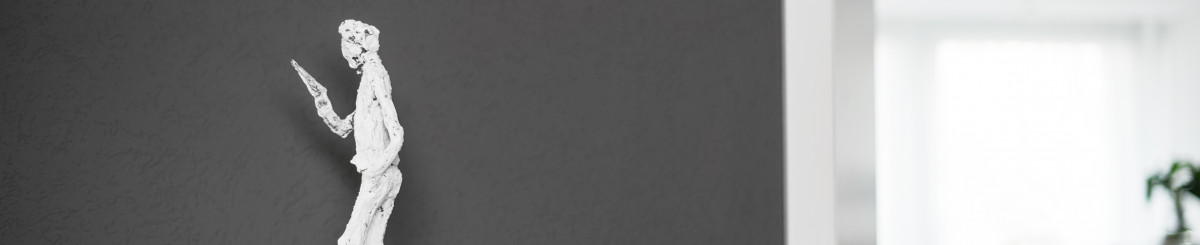Kündigung des Arbeitsverhältnisses
11. April 2025
Kündigung zur Unzeit: Darf mir während meiner Krankheit gekündigt werden?
Das schweizerische Arbeitsvertragsrecht (Art. 319 ff. OR) wird vom Grundsatz der Kündigungsfreiheit beherrscht. Diese ist Ausdruck der in der Schweiz tief verankerten freiheitlichen Wirtschaftsordnung und einer der Grundpfeiler des schweizerischen Arbeitsrechts. Für die Rechtsmässigkeit einer Kündigung bedarf es somit keiner besonderen Kündigungsgründe (BGE 138 III 362 E. 6.2.1 mit Hinweis auf den Willen des Gesetzgebers). Einzig Kündigungen, die aus einem missbräuchlichen Motiv erfolgen, sind unerlaubt. Anders formuliert: Ob eine Partei ordentlich kündigen will oder nicht, liegt grundsätzlich in ihrem Ermessen.
Einschränkung der Kündigungsfreiheit
Der Grundsatz der Kündigungsfreiheit gilt nicht unbeschränkt. Auch wenn das Arbeitsvertragsrecht von der Kündigungsfreiheit ausgeht, wird diese durch zahlreiche gesetzliche Vorschriften sachlich und zeitlich beschränkt. Eine erste Einschränkung ergibt sich durch die Kündigungsfristen. Diese verlängern sich unter Umständen durch Sperrfristen, die eine Kündigung auch ungültig machen, wenn sie während einer solchen Frist ausgesprochen bzw. der gekündigten Person zugestellt wird. Daneben kennt das Arbeitsvertragsrecht den sachlichen Kündigungsschutz, basierend auf welchem die bundesgerichtliche Rechtsprechung auch den Schutz vor Alters- und Änderungskündigungen herleitete, den zeitlichen Kündigungsschutz, den Kündigungsschutz nach Art. 335c Abs. 3 OR, den Kündigungsschutz nach Gleichstellungsgesetz sowie weitere Einschränkungen der Kündigungsfreiheit.
Der nachfolgende Artikel befasst sich mit dem zeitlichen Kündigungsschutz, dem sogenannten «Sperrfristenschutz». Dabei wird auch auf die Frage näher eingegangen, ob eine Arbeitgeberin Arbeitnehmenden, die aufgrund einer unverschuldeten Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert und arbeitsunfähig sind, kündigen darf.
Zeitlicher Kündigungsschutz
Der zeitliche Kündigungsschutz findet seine gesetzliche Grundlage in Art. 336c OR. Der Gesetzgeber bezweckt mit dem zeitlichen Kündigungsschutz, Arbeitnehmende in einer Phase vor dem Stellenverlust zu schützen, in der sie regelmässig keine Möglichkeit zur Stellensuche haben und von einer künftigen Arbeitgeberin aufgrund ihrer Arbeitsverhinderung nicht angestellt werden würden. Das Gesetz regelt die Tatbestände abschliessend.
Die in der Praxis wohl bedeutendste Sperrfrist, die während einer gesetzlich bestimmten Zeit besteht, ist, wenn die arbeitnehmende Person ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist (Art. 336c Abs. 1 lit. b OR). Im Falle von Krankheit oder Unfall, die zu einer unverschuldeten Arbeitsunfähigkeit führen, beläuft sich der Sperrfristenschutz 30 Tage im ersten Dienstjahr, 90 Tage vom zweiten bis im fünften Dienstjahr und 180 Tage ab dem sechsten Dienstjahr. Ein Beispiel dafür stellt eine Grippeinfektion dar, aufgrund welcher die arbeitnehmende Person weder ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen noch ihre Freizeit geniessen und gegebenenfalls auch keine Ferien beziehen kann. Dabei obliegt es der arbeitnehmenden Person, die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit z.B. mittels Arztzeugnissen zu beweisen.
Die während einer Sperrfrist ausgesprochene ordentliche Kündigung ist nichtig (Art. 336c Abs. 2 OR). Im Gegensatz zum sachlichen Kündigungsschutz handelt es sich hier von den Rechtsfolgen her somit um eine echte Einschränkung der Kündigungsmöglichkeit. Ist die Kündigung dagegen vor Beginn einer Sperrfrist erfolgt, aber die Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach der Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt (Art. 336c Abs. 2 Halbsatz 2 OR). Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin und fällt dieser mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. Die meisten Arbeitsverträge sehen vor, dass nur auf Ende eines Monats gekündigt werden darf. Folglich kann eine Arbeitsunfähigkeit von wenigen Tagen zu einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um einen ganzen Monat führen. Dies muss aber nicht zwingend der Fall sein, da im Arbeitsvertrag auch vereinbart werden kann, dass das Arbeitsverhältnis auf jeden beliebigen Zeitpunkt aufgelöst werden kann.
Der zeitliche Kündigungsschutz gilt nur bei einer ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Arbeitgeberin. Bei anderen Beendigungsgründen wie Zeitablauf oder einer einvernehmlichen Aufhe-bung gelangt er nicht zur Anwendung. Er gilt somit nicht, wenn im Sinne von Art. 337 OR ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung vorliegt. In diesem Fall kann das Arbeitsverhältnis auch während einer der in Art. 336c OR geregelten Sperrfristen durch den Arbeitgeber gekündigt werden. Hervorzuheben ist zudem, dass der zeitliche Kündigungsschutz erst nach Ablauf der Probezeit zur Anwendung gelangt. Ist die Kündigung während der Probezeit zugegangen, sind die Sperrfristen von Art. 336c Abs. 1 OR nicht anwendbar.
Spezialfall: Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit
In den letzten Jahren hat die Anzahl von Arbeitnehmenden, die aufgrund von Mobbing, psychischen Belastungen, Stress und sonstigen Konflikten am Arbeitsplatz erkrankt sind, stark zugenommen. Das Phänomen der arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass Arbeitnehmende für eine konkrete Arbeitsstelle an der Arbeit verhindert sind, ansonsten in anderen Lebensbereichen wie Freizeit, Hobbys oder Ferien nur minimal eingeschränkt und auch für andere Arbeiten arbeitsfähig sind. Basierend auf dem Zweckgedanken des zeitlichen Kündigungsschutzes vertritt die herrschende Lehre sowie neu auch das Bundesgericht (Urteil 1C_595/2023 vom 26.03.2024) die Ansicht, dass bei einer ausschliesslich arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit die Voraussetzungen des zeitlichen Kündigungsschutzes nicht erfüllt sind. Es bestehe daher kein Bedarf für den Sperrfristenschutz. Während der Sperrfristenschutz somit unumstritten für unverschuldete Arbeitsunfähigkeiten gilt, die durch Krankheit oder Unfall bedingt sind und sich auf sämtliche Lebensbereiche einer arbeitnehmenden Person erstreckt, entfaltet er im Falle arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit keine Wirkung.
Fazit
Im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht gewährleistet die Kündigungsfreiheit, dass Arbeitgeber grundsätzlich das Recht haben, Arbeitsverhältnisse zu beenden, ohne spezifische Gründe angeben zu müssen. Die Kündigungsfreiheit ist jedoch nicht schrankenlos, sondern unterliegt wie aufgezeigt verschiedenen Einschränkungen wie z.B. dem zeitlichen Kündigungsschutz. Ist eine arbeitnehmende Person aufgrund einer unverschuldeten Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung verhindert und arbeitsunfähig, gilt es die Sperrfristen für die Kündigung zu beachten. Für die betroffenen Parteien ist es daher bedeutend, ihre Rechte und Pflichten in einer solchen Situation zu kennen.
Die Berechnung der Sperrfristen enthält dabei einige Tücken. Sie beginnt mit dem Ereignis zu laufen, das sie gemäss Gesetz auslöst, nicht erst mit der Kündigung. Zudem kann keine Sperrfrist mehr für die Zeit zwischen dem Ende der Kündigungsfrist und dem Endtermin des Arbeitsverhältnisses bestehen. Reicht eine Sperrfrist in ein Dienstjahr, in dem eine längere Sperrfrist gilt, ist jene massgeblich, die für das Dienstjahr gilt, in dem die Verhinderung an der Arbeitsleistung abläuft (BGE 133 III 525 E. 3.3 f.). Angesichts der unterschiedlichen Rechtsfolgen rund um den Sperrfristenschutz ist es daher empfehlenswert, sich über die geltenden Bestimmungen genau zu informieren und juristische Unterstützung beizuziehen.
Autor: M.A. HSG in Law Dario Schmidli